Ein Aspekt einer Traumatherapie ist die Verarbeitung des Traumas. Der Einfachheit halber gehe ich in diesem Artikel von einem sogenannten Monotrauma, also einer einmaligen Traumatisierung aus. Zum Beispiel ein schwerer Verkehrsunfall. Komplexere, insbesondere Bindungstraumatisierungen werde ich an anderer Stelle gesondert besprechen.
Es folgt nun eine Schilderung eines Autounfalls, falls Dich das schlimm triggern könnte, lies bitte nicht weiter.
Rast zum Beispiel auf einer Landstrasse ein anderes Auto rüber auf die Spur eines Autofahrers, dann erlebt dieser zunächst das Bild des auf sich zurasenden Autos. Sein Gehirn reagiert auf dieses in Millisekunden, denn sein Körper muss nun schnellstmöglich auf diese Situation reagieren. Die Amygdala, sein „Gefahrenmelder“ im Gehirn leitet sofort wichtige Prozesse ein, um in diesem Moment schnell reagieren zu können.
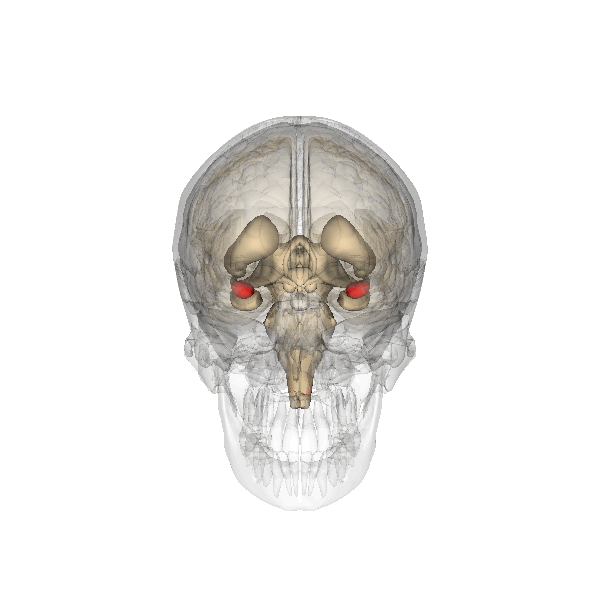
Sie informiert diverse weitere Hirnareale, die wiederum auf die Situation vorbereiten. Es beginnt die sogenannte Kampf-Flucht Reaktion. Die Muskeln spannen sich an, das Herz rast schneller, die Pupillen erweitern sich, das Gehör wird intensiver. Dies alles dient dem Zweck, sein Überleben zu sichern. Das Gehirn entscheidet in Sekundenschnelle, ob „Kampf“ oder „Flucht“ möglich wären. Da er aber im Auto sitzt, wäre beides nicht möglich. Die einzig mögliche Aktivität wäre in diesem Moment, auf die Bremse zu treten und das Steuer rum zu reissen. Dies wäre in diesem Beispiel das Pendant zu „Kampf“ (oder „Flucht“?). Beides wären Aktivitäten, die ihn potentiell retten könnten. In diesem beispielhaften Fall schaltet sein Gehirn jedoch auf „Erstarrung“, weil es realisiert, dass es aus der Situation kein Entkommen gibt. Der Körper bleibt angespannt, aber er ist nicht mehr in der Lage zu reagieren. Eventuell steigert sich das Ganze noch zur Erschlaffung, samt Dissoziation. Dies passiert, wenn sein Gehirn mit einem sehr schmerzhaften, potentiell tödlichem Ausgang rechnet. Die Erschlaffung hat evolutionsbiologisch den Zweck, den Tod vorzutäuschen (es ist ein Trick des Körpers noch aus Zeiten, wo zum Beispiel ein Raubtier Dich hätte attackieren können. Wenn Du erschlaffst -auch Totstellreflex genannt- dann denkt der Räuber unter Umständen, Du seist bereits tot und lässt im Idealfall wieder von Dir ab). Die Dissoziation wiederum ist ein Mechanismus, der in diesem Moment hilft, die möglichen Schmerzen (emotional und körperlich) ertragen zu können. Die Dissoziation führt aber auch dazu, dass verschiedene Elemente der Situation nicht mehr vom Gehirn als eine zusammenhängende Geschichte abgespeichert werden. Du kannst Dir das wie ein Puzzle vorstellen, dessen Teile auseinander fallen. Auf einem Teil war das Bild des Ereignisses, auf einem anderen die Geräusche, auf einem weiteren der Moment des Aufpralls des anderen Autos mit dem Klirren der Scheiben usw. Bedingt durch die Dissoziation und die Ausschüttung von Endorphinen verspürt der Fahrer möglicherweise keinen Schmerz direkt nach dem Unfall. Es kommt daher gelegentlich vor, dass Personen nach einem Unfall orientierungslos umher laufen und die Schwere der Situation nicht realisieren.
Nach dem Unfall kam es womöglich dazu, dass ein Krankenwagen kam, die Person erstversorgt und dann in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Möglicherweise gab es einen Armbruch oder andere Verletzungen. Zum Glück waren die körperlichen Verletzungen in diesem Beispiel nicht so schlimm, so dass die Person bald entlassen werden konnte.
In den nächsten Tagen schläft unser Fahrer schlecht. Immer wieder sieht er das Bild vom herannahenden Auto vor sich. Doch dann beginnt ein „Filmriss“. Die nächsten Erinnerungen sind, wie er im Krankenhaus liegt. An alles dazwischen kann er sich nicht mehr erinnern. Dieser Abschnitt wurde von ihm dissoziiert und ist im Moment dem Gedächtnis nicht mehr zugänglich. Wenn diese Erinnerungen hoch kommen, rast jedoch sein Herz, er schwitzt, die Muskeln spannen sich an. Der Körper reagiert genauso, wie im Moment des Unfalls. Eventuell spürt er körperliche Schmerzen, denn sein Körper erinnert den Aufprall. Die Erinnerung ist „implizit„, steht aber dem explizitem“ Gedächtnis nicht zur Verfügung. Manchmal schreckt er hoch, weil er den Knall des Aufpralls erinnert.
In seinem Körper geschieht eine „als ob“-Reaktion. Er reagiert, also ob der Unfall genau jetzt erneut passieren würde. Die Situation ist für das Gehirn nicht abgeschlossen. Auf Grund der Dissoziation sind die „Puzzlestücke“ nicht wieder zusammen gesetzt und das Gehirn reagiert erneut, wieder mit dem Ziel, das Überleben zu sichern, aber mit dem Unterschied, dass in diesem Moment gar keine Lebensgefahr herrscht. Ich erkläre meinen Klient*innen oft, dass Traumatherapie die Aufgabe hat, „dem Gehirn die Verwechslung von Vergangenheit und Gegenwart wieder zu nehmen“. Die Ursprungssituation konnte nicht abgeschlossen werden. Diesen Prozess holen wir in der Traumatherapie nach. An dem Beispiel wird deutlich, warum Traumatherapie immer den Körper (das Körpererleben) einbeziehen sollte. Denn hier zeigt sich die Traumasymptomatik primär.
Besonders schlimm wird dies, wenn bestimmte Auslöser ihn an den Unfall erinnern. Besonders herausfordernd ist natürlich das Autofahren selbst. Immer wenn er es versucht bekommt er feuchte Hände, sein Herz rast und er sieht sich nicht in der Lage, den Motor zu starten. Das liegt daran, dass seine Amygdala, deren Zweck es ja eigentlich ist, unser Überleben zu sichern, nun durch bestimmte Auslöser überreagiert und lieber zu schnell und zu viel Reaktionen produziert, als zu wenig. Diese Symptomatik führt in dann letztendlich auch in eine Traumatherapie.
Was passiert in der Traumaverarbeitung?
Um das Erlebte zu verarbeiten braucht es mehrere Komponenten. Bisher habe ich vor allem über die physiologischen und emotionalen Konsequenzen einer Traumatisierung gesprochen. Zusätzlich gibt es oft solche, die mit dem Selbstbild zu tun haben. Es können starke Scham oder Schuldgefühle entstehen („warum habe ich nicht….“, „Hätte ich doch…“, „Ich bin einfach zu….“). Auch diese Ebene sollte in der Therapie bearbeitet werden. Manchmal stehen noch ganz andere Themen an, bevor es an die Verarbeitung geht. Manchmal zum Beispiel hat sich eine Person in ein süchtiges Verhalten begeben in der Hoffnung, so die Traumsymptome in der Griff zu bekommen. Dann sollte diese möglicherweise zuerst in der Therapie bearbeitet werden. Dies alles sind wesentliche Aspekte einer (Trauma-)Therapie. Die Traumaverarbeitung ist dabei nur ein Teil der Therapie. Wir gehen nun in diesem Beispiel der Einfachheit halber davon aus, dass unser Fahrer „nur“ die sich aufdrängenden Erinnerungen mit den dazugehörigen physiologischen und emotionalen Reaktionen hat.
Ich habe bereits beschrieben, wie verschiedene Elemente der auslösenden Situation fragmentiert im Gedächtnis abgelegt werden (Die „Puzzlestücke“). Gleichzeitig ruft die Erinnerung an das Trauma oft entweder Übererregung, also sehr starke Emotionen hervor, oder auch Untererregung, also ein emotionales abgekoppelt sein von dem Erlebten. Nun braucht es aber zur Neuvernetzung einer Erinnerung, dass das neuronale Netzwerk, was diese enthält, zunächst aktiviert werden muss. Darum ist es in der Traumaverarbeitung unerlässlich, die Erinnerung zu reaktivieren. Die Herausforderung für Therapeut*in und Klient*in besteht nun darin, diese Erinnerung nur so weit aufsteigen zu lassen, dass sie zwar emotional spürbar wird, aber nicht „überschwemmend“ ist. Wie kann man das hinbekommen?
Nun, das ist zum einen der Grund, warum in der Traumatherapie vor der eigentlichen Verarbeitung das Einüben von Ressourcen- und Stabilisierungsübungen ansteht, denn diese sollen gewährleisten, dass falls die Emotionen doch zu herausfordernd werden, diese jederzeit wieder reguliert werden können. Den genauen Ablauf einer Traumatherapie schildere ich demnächst in einem anderen Blogartikel. Hier sei aber bereits erwähnt, dass eine Traumatherapie aus 3 (in manchen Modellen 4) Phasen aufgebaut ist: 1. Anamnese/Diagnostik, 2. Stabilisierungsphase, 3. Traumaverarbeitungsphase, 4. Neuorientierungsphase.
Ist die Person, die ihr Trauma verarbeiten möchte vom inneren und äusseren Umfeld her stabil genug, dass sie sich emotional gut selbst regulieren kann, dann kann also die Phase der Traumaverarbeitung beginnen.
Eine adäquate Methode der Traumaverarbeitung, sollte gewährleisten, dass diese unterstützend bei der Selbstregulation ist. Die meisten heutzutage angewandten Methoden machen sich dabei das Prinzip der Bifokalität zunutze. Das bedeutet, dass immer zwei Fokusse bestehen. Ein Fokus liegt auf dem Traumaerleben und einer auf einer Ressource. Oder auch einer in der Vergangenheit und einer im Hier und Jetzt. Einer auf der Bedrohung und einer auf der Sicherheit. Je nach Methode wird dies unterschiedlich bewerkstelligt. Im Brainspotting ist es zum Beispiel die Ressourcen-Blickrichtung und die Aktivierungsblickrichtung. Beim Somatic Experiencing wären es die Ressourcenort im Körper und der Bereich, an dem sich die körperliche Empfindung in Bezug auf das Trauma zeigt. Im EMDR wird sich innerlich mit der traumatisierenden Situation verbunden, oder zum „sicheren Ort“ gewechselt. Das ist eine sehr verkürzte Darstellung der Methoden, aber ein zentrales Element einer Methode sollte sein, dass die Person, die ihr Trauma verarbeiten möchte, jederzeit eine schnelle Regulationsmöglichkeit hat, falls die durch die Erinnerung ausgelösten Emotionen zu intensiv werden.
Wenn jemand Schreckliches erlebt hat, warum sollte sie/er sich dann wieder daran erinnern müssen?
Um eine Traumaerinnerung zu verarbeiten, ist es leider notwendig, diese erst mal zu aktivieren (sprich, sich wahlweise bewusst zu erinnern, oder -je nach Methode- die körperlichen Auswirkungen in Bezug auf bestimmte heutige Auslöser wahrzunehmen),denn dies aktiviert die neuronalen Netze, in denen die Erinnerung liegt. Diese Aktivierung ist eine Bedingung für eine Neuvernetzung. Zugleich möchte sich aber natürlich niemand noch einmal genau so fühlen, wie in der Ursprungssituation. Darin liegt die große Herausforderung der Traumaverarbeitung. Die Erinnerung sollte durchaus emotional sein, aber nicht zu herausfordernd. Das Ziel ist es, emotional im sogenannten Toleranzfenster zu bleiben. Im Toleranzfenster zu bleiben heisst, in der Lage zu sein, die Traumaerinnerung zu fühlen (emotional und körperlich), aber von diesem Gefühl nicht überschwemmt zu werden. Immer sollte die Person in der Lage sein, noch festzustellen, dass sie Hier & Jetzt nicht in Gefahr ist, sondern sich nur an die Gefahr erinnert.
Eventuell braucht es dazu ab und an eine Reorientierung, zum Beispiel durch die 5,4,3,2,1 Übung. Traumaverarbeitung ist also eine Gratwanderung zwischen dem „zu wenig“ (nicht fühlen, dissoziiert sein) und dem „zu viel“ (von den Emotionen überschwemmt sein, sich so fühlen, als ob alles jetzt wieder passiert). Wenn es gelingt, im emotionalen Toleranzfenster zu bleiben, dann können die Erinnerungen wieder hoch kommen und nach und nach verarbeitet werden. Das heisst zum einen, dass sich die „defragmentierten Puzzlestückchen“ wieder zusammen setzen (in unserem Beispiel des Autofahrers würde er vielleicht nach und nach alle Elemente des Unfalls wieder erinnern und in eine kongruente Reihenfolge bringen können), zum anderen aber lernt unser Gehirn in der Traumaverarbeitung, dass die Gefahr vorüber ist. In anderen Worten: Wir bringen der seit dem Unfall äusserst leicht erregbaren Amygdala bei, dass sie zukünftig wieder angemessen reagiert. Angemessen würde in unserem Beispiel bedeuten, dass eine normale Autofahrt ohne die emotionalen und körperlichen Symptome wieder möglich wird und sie dennoch schnell reagiert, wenn eine reale Gefahr droht.
Ein wichtiger Aspekt ist hierbei: Traumaverarbeitung löscht nicht die Erinnerungen an ein Trauma, sondern sie setzt an den Reaktionen auf dieses an. Im Idealfall kann sich die Person dann komplett an das Trauma erinnern, aber bleibt frei von den überwältigenden emotionalen und physiologischen Reaktionen, die die Ursprungssituation bestimmt hatten. Wenn dies möglich geworden ist, dann kann das Ereignis in die eigene Biografie integriert werden, ein Teil der eigenen Geschichte werden, der nicht schön war, aber dessen Auswirkungen aufs Heute regulierbar sind. Bezogen auf unser Beispiel mit dem Autounfall würde dies bedeuten, dass der Fahrer wieder entspannt in ein Auto steigen kann und ohne Herzrasen und Angst auf der Landstrasse fahren kann, ja sogar am Ort seines damaligen Unfalls vorbei fahren kann, ohne dass die starken emotionalen Reaktionen beginnen.
Zusammenfassung: Zur Verarbeitung eines Traumas ist es notwendig, sich an dieses zu erinnern (oder emotional-physiologische Reaktionen in Bezug auf einen Auslöser zu erleben – nicht alle Traumata werden explizit erinnert, manche nur implizit). Es braucht die physiologisch-emotionale Reaktion, um das neuronale Netzwerk zu aktivieren, welches neu verschaltet werden soll. Die Reaktion auf die Erinnerung sollte so gut wie möglich im emotionalen Toleranzfenster gehalten werden. So kann dem Gehirn nach und nach beigebracht werden, nicht mehr zu stark auf ein in der Vergangenheit liegendes Ereignis zu reagieren.
Ich habe bewußt ein überschaubares Ereignis genommen – ein Monotrauma. Leider ist Trauma oft deutlich komplexer und leider gibt es Personen, die etliche Traumatisierungen erlebt haben. Herausfordernder in der Verarbeitung sind zum Beispiel Traumata, die durch Bezugspersonen entstehen und solche, die chronisch sind. Hier entstehen komplexere Herausforderungen, weil sie gleichzeitig einhergehen mit Schuldgefühlen, ambivalenten Emotionen (z.B. „ich liebe ihn doch, warum tut er mir das an?“), einem Grundverlust des Sicherheitserlebens, tiefen Mißtrauen in alle Menschen usw. Die Verarbeitung früher, komplexer Traumatisierung dauert entsprechend länger und muss mehr Ebenen beachten als die Verarbeitung eines Monotraumas, denn sie hat die Person in essentiellen Kernthemen wie Sicherheit, Geborgenheit, Vertrauen in tiefste Verunsicherung geführt.
Wenn Stabilisierung nicht oder nur wenig gelingt, oder die Menge an erlebten Traumatisierungen zu immens erscheint, kann es sinnvoll sein, auf andere Methoden zurück zu greifen. TRIMB ist zum Beispiel eine Methode, die sich bewährt hat, bei Personen, denen Stabilisierung nur schwer gelingt.